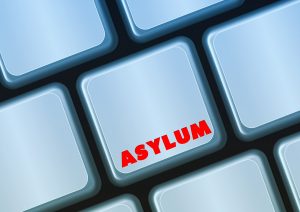Einem Ausländer kann der subsidiäre Schutz verweigert werden, wenn er sich strafbar gemacht hat. Das sieht schon Art. 17 der Richtlinie 2011/95/EU (sogenannte Qualifikationsrichtlinie) vor. Auch der deutsche Gesetzgeber hat die hier maßgeblichen Art. 17 Abs. 1 und 2 der Qualifikationsrichtlinie in § 4 Abs. 2 des AsylG in das nationale Recht übernommen.
Auch ein einmal erworbener Schutzstatus kann widerrufen werden. Gemäß § 73 Abs 1 Satz 1 AsylG ist die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft unverzüglich zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für sie nicht mehr vorliegen. Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG und § 60 Abs. 8 AufenthG können zudem die Asyl- und Flüchtlingsanerkennung widerrufen werden, wenn der Ausländer eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und wegen eines Verbrechens oder besonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einer mindestens dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH, Urt. v. 13.09.2018, Az. C-369/17) hat nun für die Fallgruppe der Verweigerung des Schutzes entschieden, dass bei der vorausgehenden Abwägung nicht allein auf das Strafmaß nach dem nationalen Recht abgestellt werden darf. Die nationalen Behörden müssten vielmehr alle besonderen Umstände des jeweiligen Einzelfalles bewerten. So hatte der EuGH bereits in einem deutschen Fall entschieden. Hierbei durfte einem türkischer Staatsangehöriger wegen seiner Zugehörigkeit zur PKK nicht automatisch der Flüchtlingsschutz verwehrt werden (EuGH, Urt. v. 09.11.2010, Az. C-57/09 u. C-101/09).
Der EuGH betonte, langfristiges Ziel der Qualifikationsrichtlinie sei die Vereinheitlichung der beiden Schutzstatus, also des Flüchtlingsschutzes einerseits und des subsidiären Schutzes andererseits. Eine Differenzierung zwischen diesen Schutzstatus sei gerade nicht im Sinne der Richtlinie. Daher sei die Rechtsprechung zum Flüchtlingsschutz auf den subsidiären Schutz zu übertragen. Eine schematische Anwendung des Ausschlussgrundes, die alleine aus dem Vorliegen eines Straftatbestandes mit einem bestimmten Mindeststrafmaß auf das vorliegen eines Ausschlussgrundes schließt, verbiete sich daher.
Quelle: EuGH, Urt. v. 13.09.2018, Az. C-369/17; EuGH, Urt. v. 09.11.2010, Az. C-57/09 u. C-101/09; www.lto.de